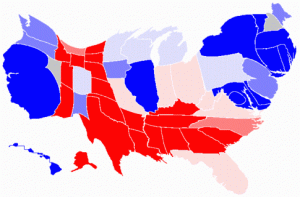Angesichts der amerikanischen Finanzkrise waren die Erwartungen an die TV-Debatte zwischen Barack Obama und John McCain, die sich diese Nacht abspielte, hoch. Man erwartete, das mit diesem ersten Höhepunkt im amerikanischen Wahlkampf auch eine erste Vorentscheidung gefällt werde. Zwischenzeitlich ist die Stimmung gedämpfter: Unentschieden lautet das fast schon enttäuschende Verdikt der Auguren. Also waren wir Politikkonsumenten auf den entscheidenden Schlag in der nächsten Runde!

Position 1: Medien ohne Einfluss
Paul Lazarsfeld prägte mit seiner soziologisch inspirierten Wahlstudie “The people’s choice”, die 1944 erschien, den ersten Klassiker, der der bis heute gängigen Pole in der wissenschaftlichen Deutungen von Medien und Wahlen bestimmte. Typisch für seine Antwort ist die sog. Verstärker-These. Demnach üben die Massenmedien keinen genuin verändernden Einfluss auf die Wahlentscheidung aus, denn ihre Botschaften prallen an bestehenden Einstellung ab, wenn sie diese nicht bestätigen. Von meinungsbildender Wirkung bleibt da nicht viel übrig. Entsprechend ist nicht zu erwarten, dass sich diese Nacht etwas Wesentliches im amerikanischen Wahl verändert hätte. Vielmehr gilt: Demokraten bewerten Obama besser, und für Republikaner ist McCain der geeignetere Kandidat.
Position 2: Medienbild bestimmt Politikbild
1980 erschien unter dem Titel “The mass media election” die Studie von Thomas E. Patterson, die bis heute den klassischen Gegenpol zu Lazarsfeld und seinen Mitstreitern bildet. Anhand einer Untersuchung der Präsidentschaftswahlen von 1976 kam er zu folgenden Befunden und Schlüssen:
Erstens, die Bedeutung der Massenmedien liegt darin, dass sie mit ihrer Auswahl die für die WählerInnen relevante Wahrnehmung der Politik prägen.
Und zweitens, die Wahlentscheidungen fallen unterschiedlich aus, je nachdem wie die massenmediale Informationsauswahl ausfällt.
Das wichtigste Argument, das für einen Medieneinfluss spricht, ist die medienbestimmten Fokussierung auf kontroverse Themen mit klarer Pro- und Kontra-Struktur: Wer polarisiert, hat einen Vorteil. Wer indessen integriert, verliert bereits hier an Terrain. Denn Massenmedien neigen nach Patterson dazu, aus Spannungsgründen Politik als Spiel zu inszenieren, als Wettkampf bei dem es Helden und Versager, Gute und Böse, Gewinner und Verlierer gibt.
Kommentar
Nur schon die allgemeine Einschätzung von Patterson zu Medien und Politik erhellt unsere Erwartungshaltung an die amerikanischen TV-Duelle, die zwischenzeitlich weltweit die Medienberichterstattung bei Wahlen bestimmen. Es geht bei öffentlichen politischen Debatte nicht mehr darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Egal um was es geht, eine Politik der Verständigung ist massenmedial gar nicht mehr gefragt. Vielmehr sucht man wie fixiert nach den berühmten 10 Unterschieden. Bei Wahlen, die stets auch Auswahlen sind, kann man damit auch leben. Das Problem aber besteht darin, dass nicht mehr die politischen Inhalte bestimmend sind, sondern meist nur noch die medial inszenierte Persönlichkeiten der KandidatInnen.
Nach Patterson machte es einen Unterschied aus, ob man sich ausschliesslich über das Fernsehen oder im Mix von TV und Printmedien informiert. Das Fernsehen reicht weiter in die Wählerschaft, und es ist bei WählerInnen mit geringerem politischem Interesse die einzige zentrale Informationsquelle. Demgegenüber sind Printmedien bei die interessierteren WählerInnen wichtiger, und die Zeitungen können auch informativer sein.
Wenn man sich die heutigem Realtionen auf die gestrige TV-Debatte ansieht, kann man auch Zweifel an dieser Einschätzung haben. Die hohen Erwartungen an das Duell seien nicht eingelöst worden hört man da. Beide Kandidaten seien bezüglich der Finanzkrise vorsichtig aufgetreten. Und keinem sei es gelungen, sich wirklich vom anderen zu unterscheiden. So bleibt der sichtbarste Gegensatz bestehen: Obama und McCain vertreten je eine andere Generation.
Unentschieden war denn auch das Urteil der meisten Kommentatoren. Das wohl auf den entscheidenden Schlag bei einer der beiden kommenden Sendungen, den wir PolitikkonsumentInnen dannzumal hoffentlich alle gesehen haben werden.
Claude Longchamp
Quelle:
Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, Hazel Gaudet: The people’s choice. How the voter makes up his mind in a presidential campaign. New York 1944.
Thomas E. Patterson: The mass media election. How Americans choose their president. New York 1980.