Nach deinem Insistieren in Sachen Sinus-Milieus versuche ich es nochmals. Beispielhaft, um das Abstrakte einzubetten, und direkt, um auf deine brennenden Fragen einzugehen. Lass uns schweben, von deinen Reiseplänen, über das Transfigurative in der Gesellschaft bis hin zur Pragmatik von Milieustudien.
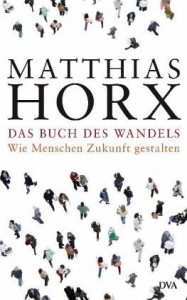
Wem streng empirische Studie zu abstrakt sind, wenn es um die (nahe) Zukunft geht, der (oder die!) wird bei Matthias Horx wohl fündiger, denn er beschreibt konkret, wie Wandel, auch soziokultureller menschengemacht vorkommt.
Das Einfache der eigenen Biografie
Beginnen wir mit einem Gedankenspiel. Wohin gehst du in die Ferien? War das immer so? Was hat sich geändert, seit du Studentin der Biochemie wurdest? – Ich nehme an: viel. Denn die Ferienwahl ist ein Teil der biografischen Entwicklung, auf der Suche nach Identität, in Verbindung mit der Berufskarriere, und stark abhängig von der familiäre Situation. PsychologInnen würden sagen, Ferienwahl hat etwas mit dem Lebenszyklus zu tun, indem man steckt.
Du siehst, individuell kann sich viel ändern. Aendert sich deshalb auch gesellschaftlich etwas? Nicht zwingend, ist die Antwort der Demografen. Denn wenn eine Gesellschaft gleich komponiert bleibt, ersetzen neue Individuen alte, doch die Gesellschaft als Kollektiv bleibt sich gleich. Denk an einen Ameisenhaufen, der immer gleich aussieht, auch wenn einzelne Viecher sterben oder geboren werden.
In westlichen Gesellschaften ist das aber nicht so. Die Alterspyramide ist in erheblicher Veränderung begriffen. Es stehen immer mehr ältere Menschen immer weniger jüngeren Gegenüber. faktisch bekommen wir eine Alterskerze. Unser Gedankenspiel in der heutigen Gesellschaft bedeutet deshalb: die Themen im Lebenszyklus, die einem höheren Alter verbunden sind, werden zahlreicher, jene der jüngeren werden verringert. Gesamtgesellschaft ändert sich etwas.
Das Komplizierte der Generationen
Faktisch ist alles aber noch komplizierter. Denn die neuen Jungen finden auch andere Lebensbedingungen vor als ihre Vorgänger-Jungen: Es ist kein Krieg mehr, der Konsum aus Prestigegründen ist gesättigt und die Rebellion der 68er ist vorbei. Dafür spricht man von Individualisierung, von Multioption, von Genuss, von Flexibilität, von Unsicherheit, kurz von einer Hybridkultur, mit der man zu Rande kommen müsse. Das alles prägt(e) ganze Generationen. Diese definieren sich daraus, dass sie neue Antworten auf neue Fragen geben. Sie grenzen sich damit von den vorhergehenden Generationen ab. Generationen entstehen nicht jedes Jahr neu, auch wenn das Marketing das so sieht. Vielmehr gibt es zyklisch neue Generationen, die man teilweise erst im Rückblick wirklich unterscheiden kann.
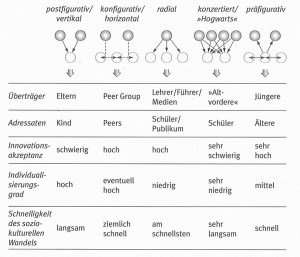
Treiber des soziokulturellen Wandels in der transfiguralen Gesellschaftskonstellation (Quelle: Horx: Wandel)
Was wir nun haben, müssen wir noch interkulturell differenzieren. Margaret Mead, die grosse amerikanische Anthropologin des 20. Jahrhunderts untersuchte in ihrer Schrift “Der Konflikt der Generationen” verschiedenste Kulturen dieser Welt. Sie kam zum Schluss, dass es drei typische Konstellationen gibt im Verhältnis von Kindern und Eltern:
. die postfigurative Konstellation, die sich an der Vergangenheit orientiert, in der die Eltern ihre Werte auf ihre Kinder übertragen konnen, die wenig flexibel ist und in der Generationeneffekte kaum identifiziert werden können,
. die konfigurative Konstellation, die sich an der Gegenwart ausrichtet, wo die Kinder nicht einfach die Eltern nachahmen, sondern sich an den Antworten der Gleichaltrigen ausrichten, die deshalb flexibler sind, und in denen eigentliche Generationen von Kindern, Jugendlichen und Eltern ersichtlich werden.
. und die präfigurative Konstellation, die auf die Zukunft gerichtet ist, weil die Kindern den Wandel schneller aufnehmen als ihre Eltern, diese fordern und lehren. Solche Gesellschaften sind nicht nur flexibel, der soziale Wandel wird durch die Jugend vorangetrieben.
Machen wir auch hier ein Beispiel: Wählst du gleich wie Deine Eltern? In einer durchunddurch postfigurativen Kultur würden hier alle mit “Ja” Antworten. Das ist heute bei den konfessionell gebundenen Parteien, der CVP und EVP auch noch überwiegend der Fall. Bei allen anderen kommt es nur noch minderheitlich vor. Weil es Generationenbrüche gibt, mit denen man, aus einem FDP-Haushalt stammend, nun SP wählt, oder weil man genug hat von der CVP, welche die Schweizer nicht genug hochhält und nun bei der Jungen SVP ist. Das ist typisch für die konfigurative Konstellation. Die Diskussionen unter Gleichaltrigen übertreffen die Wirkungen des familiären Mittagstisches.
Das Komplexe an der Zukunftsgesellschaft
Anhand der neuen Medien kann man sogar noch weiter gehen. Die Kids der etablierten Manager sagen ihrem Vater, wenn seine Firma nicht bald twittert, auf facebook ist, dann werde sich von der eigenen Geschichte eingeholt werden. Denn dann würden sie, die Kids, in den social media über die Firma berichten. Das ist typisch präfigurativ.
Vielleicht wird daraus sogar mehr: Der Zukunftsforscher Matthias Horx (“Das Buch des Wandels”) hat die bisher höchste Komplexität der Analyse angetönt: Bis 1968 waren Gesellschaften wie die schweizerische postfigurativ, wurden dann konfigurativ, und entwickeln sich heute zum präfigurativen. Für die Zukunft sieht er eine transfigurative Konstellation aufkommen, in der sowohl die Medien wie auch der Wächterrat von Bedeutung sein werden:
. die Medien mit ihren Vorbildern (Roger Federer, Paris Hilton oder Christoph Blocher), die Grundorientierung von leistungsorientierten, erfolgsverwöhnten Sportlern, von Tussis, die keinem sexuellen Experiment abgeneigt sind, aber auch von nationalkonservativen Patriarchen, für die Wirtschaft wie Politik Status ist, in die ganze Gesellschaft transportieren und Milieus tendenziell auf (denn wir alle werden ein wenig hybride Gesellschafts- und PolitikkonsumentInnen) auflösen,
. sodass es soziokulturelle Wächterräte braucht, die über die Familien hinweg für ordnende Leitbilder in der Mediengesellschaft sorgen: die Eliteschulen wie die HSG für angehenden Leader, das Opus Dei, um die katholische Kirche vor dem Zerfall zu retten, und die SVP, die abschliessend definiert, wer eine guter Schweizer ist und wer nicht. Damit sind sie in der Definition des soziokulturellen Wandels erheblich, beeinflussen bisherige Milieus oder lassen auch neue entstehen!
Das Pragmatische von Milieustudien
Die Milieu-Studien der Socio Vision, über die wir uns ja unterhalten haben, sind ein Kombi von dem. Sie beobachten Menschen in ihrem Lebenszyklus. Sie beschreiben aber auch den kulturellen Wandel ganzer Gesellschaften. Dabei interessieren sie sich für drei Sachen: die Schichten, die sich ändern (aufgrund von Ausbildung, Alterung und Migration), und die Grundhaltungen, die sich beschreiben lassen. Jede(r) von uns hat da seine Position, idealtypisch mitten in einem Milieu, oder als Mischgruppen am Rande von Milieus. Die Zuordnung kann sich im Verlaufe eines Lebens ändern, muss sich aber nicht. Aenderungen sind bei hoher Mobilität, räumlich oder sozial zu erwarten: So beginnt man beispielsweise als Eskapist, wird zum Postmateriellen und endet bei den Arrivierten. Es ändern sich aber auch Milieus. In Deutschland, weil die DDR mit ihrer Milieu-bildenden Kraft der Geschichte angehört, in der Schweiz, weil die Arbeiterschicht nicht einfach mehr arm und links ist, sondern sich konsumorientiert an der Mittelschicht ausrichtet und politisch national denkt.
Der Vorteil von Milieustudien, wie sie hier diskutiert wurden, liegt darin, dass sie komplex genug sind, um der sozialen Realität einigermassen gerecht zu werden, aber auch nicht überkomplex sind, sodass sie zu keinerlei Anwendung führen. Es sind Forschungsprojekte, für die Praxis gedacht, also für dich, nicht für die Grundlagenforschung. Die ist zwar auch am Thema dran, neigt aber dazu, zu stark zu verallgemeinern. Wenn du dich selber überzeugen willst, lies das Buch von Gerhard Schultze, “Die Erlebnisgesellschaft”, der sich mit den gleichen Phänomenen beschäftigte, wohl aber weniger konkrete Angaben machen konnte.
So, ich hoffe, du verstehst mich jetzt besser.
Claude Longchamp