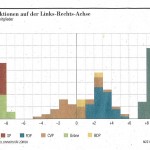Noch in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts war es in der politikwissenschaftlichen Analyse üblich, die Entstehung populistischer Bewegungen an bestimmte Momente zu knüpfen, die einschneidende Brüche darstellten und zu Entwicklungen von Protest ausserhalb des Parteiensystems führten. Das sei passé, meint der Rostocker Politikwissenschafter Nikolaus Werz, der von einem strukturellen Populismus der Informationsgesellschaft spricht, der neue Ursachen habe und neue Fragen aufwerfe.
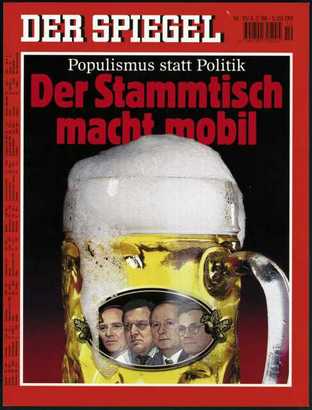
Der Populismus ist selber in den etablierten Demokratie Westeuropas Teil der politischen Kultur und des politischen Systems geworden. Dabei verändert er den Stil der Demokratie, ohne sie zu zerstören, ist eine zentrale Botschaft des hier besprochenen Buches von Nikolaus Werz
Natürlich ist Italien das meist diskutierte Anschauungsbeispiel für das, was die neue Fragestellung zum Populismus ist. Drei Parteien, die allesamt populistischen Charakter haben, bilden seit dem Zerfall der traditionellen bürgerlichen Parteien fast ununterbrochen die Regierung, ohne dass die linken demokratischen Kräfte dem “Projekt Berlusconi“, das auf immer mehr Machtkonzentration ausgerichtet ist, ernsthaft etwas entgegenhalten können.
Aehnliches kommt aber auch anderswo vor, in Oesterreich, in der Schweiz, in Belgien, in den Niederlanden, Dänemark, ja in Deutschland und Frankreich, was die Diskussion der Phänomen über eine Beurteilung Italiens hinaus interessant macht.
Das politikwissenschaftlich unvoreingenommen zu analysieren, ist die Absicht der Analysen, die der Rostocker Politikwissenschafter Nikolaus Werz in einem Sammelband vorgelegt hat. Sein Fazit: Während in West- und Osteuropa der Rechtspopulismus dominiert, lässt sich in Nord- und Südamerika ein Populismus feststellen, der linke wie rechte Erscheinungsformen verbindet. Die Demokratie ist dabei nicht einfach abgeschafft worden, wenn auch in ihrem liberalen Verständnis erschüttert.
Der Frankfurter Historiker und Politologe Hans-Jürgen Puhle versucht, das in einem gewichtigen Ueberblickskapitel zu synthetisieren: Gesprochen wird von einem Designer-Populismus, einem neuen Politikstil, der sich in der Demokratie etabliert hat und genau deshalb regelmässig für Kontroversen sorgt. Seine Symptome sind die Sehnsucht nach Leadership und führungszentrierter Parteipolitik, was zu einer Dominanz der SpitzenpolitikerInnen kombiniert mit einer ideologsichen Beliebigkeit führe, die eine pragamtische Behandlung des Augenblicks mit einem gehörigen Schuss an medialer Empörung zur Folge hat. Der Bonapartismus ist, bilanziert Puhle, zum Element der etablierten Parteienpolitik und damit auch zu einem Kennzeichen der Staatspolitik geworden.
Für diesen strukturellen Populismus werden im Sammelband fünf Ursachen genannt:
. erstens, die Mobilisierung gegen die Globalisierung, als Interessen- und Machtkartell, begründet durch neoliberale Politik, welche den Rückzug des Staates auf zentralen Feldern der Konfliktregelung fordert;
. zweitens, einen generellen Antimodernismus, der unter den VerliererInnen von Transformationsprozess jedweder Art SympathisantInnen findet;
. drittens, den Bedeutungsverlust von Grossorganisationen wie Parteien und Verbänden aber auch des Staates, angesichts stagfaltionärer Veränderungen, bei denen der Umbau des Staats weg vom keynsianistischen Wohlfahrtsstaat am Anfangs steht,
. viertens, parteiinhärente Probleme vor allem von catch-all parties, die den Zusammenhalt ihrer AnhängerInnen nur noch gewährleisten können, wenn der richtige Nerv der Zeit permanent getroffen wird,
. und fünftens, die Auswirkungen der new campaign politics mit elektronischen Medien, welche die Lösung von Sachfragen in den Hintergrund treten lassen, dafür aber auf die Vermehrung von Glaubwürdigkeit zentraler Führungspersonen ausgerichtet sind.
Soweit die Analyse. Brisant ist der Schluss, der in Uebereinstimmung mit konservativen Politikverständnissen daraus gezogen wird: Populismus sei zu einem mehr oder weniger dauerhaften Bestandteil demokratischer Systeme geworden, ohne dass sie sich früheren, marxistisch inspirierten Vermutungen, Populimus führe zwangsläufig zu Bonapartismus und der automatisch zu semi- und vollfaschistischen Regimes bewahrheitet hätten.
Die Politikwissenschafter ziehen daraus auch den Schluss, die Populismus-Analyse solle untersuchen, wie dominant gewordene Politikstil heute in der Regierungs- und Parteienpolitik generell verwendet werden, um Wahlen zu gewinnen und Regierungen zu stabilisieren.
Claude Longchamp
Nikolaus Werz (Hg.): Populismus. Populisten in Uebersee und Europa. Opladen 2003